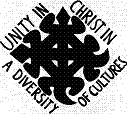von 1800 – 2000
Kwasi Boakye (1827 – 1904)
Ira Frederick Aldridge (1807 – 1867)
John Glatty (1872 – mindestens 1910)
Christian Jakob Protten (1715 – 1769)
und seine Frau Rebecca (1718 – 1780)

Kwasi Boakye
(Aquasie Boachi, 1827 – 1904)
Ein Akanprinz als Student in Freiberg
„Lieber in Europa den Tod gefunden,
als in Guinea (heute Ghana)
langsam vor Kummer untergehen…“
Kwasi Boakye war 10 Jahre alt, als er mit seinem Neffen Kwame Poku nach Europa kam. Sie sollten hier eine gute Ausbildung erhalten. Die beiden Prinzen kamen zunächst in die Niederlande. Der junge Kwasi interessierte sich für die Naturwissenschaften und besuchte die Königliche Akademie in Delft, während sein Neffe Kwame auf den Militärdienst vorbereitet wurde.

1847 wurde Kwasi Boakye (inzwischen 20 Jahre alt) auf die Berg- akademie in Freiberg/ Sachsen geschickt. Er sollte sich Kenntnisse und Fertigkeiten für einen möglichen Einsatz im Goldbergbau aneignen. Diesen wollten die Niederländer mit modernen Methoden an der Goldküste entwickeln.

Die Bergakademie in Freiberg war eine internati- onal anerkannte Lehranstalt und bestand bereits seit 1766. Das Fächerspektrum umfasste Mineralogie, Physik, Physikalische Chemie, Allgemeine Markscheidekunst, Bergbaukunst, Hüttenkunde, Geognosie sowie Praktische Chemie.
Im Abschlusszeugnis, das man Boakye nach zweijährigem Aufenthalt ausfertigte, wurden ihm „guter bis ausgezeichneter Fleiß“ und teilweise „sehr gute Fortschritte“ in den einzelnen Fächern bescheinigt.
Außerhalb seiner Studien wurde Boakye schnell in die Kreise des Bürgertums und des Adels eingebunden. Sie schätzten seine freundliche Ausstrahlung und vielleicht auch seine exotische Erscheinung bzw. Seinen Status als “Akanprinz”. Boakye fühlte sich im Umfeld der Freiberger Akademie, in einer Atmosphäre vielfältiger geistig- künstlerischer Interessen wohl und vorbehaltlos angenommen. Zu seinem großen Freundeskreis zählte die Großherzogliche Familie zu Weimar ebenso wie die Familie von Serre auf Gut Maxen bei Dresden, wo sich ein Treffpunkt der geistig- künstlerischen Elite gebildet hatte.
1849 musste Boakye sein Studium vorzeitig beenden. Er bekam Druck von den Niederlanden, die ihn zurück an die Goldküste (heute Ghana) schicken wollten. Dort sollte er ihnen helfen, Gold abzu- bauen. Boakye bekam Panik. Ein Leben in seiner Heimat kam für ihn nicht mehr in Frage. Freunde und Lehrer machten sich für ihn stark, besonders ein Herr von Wangenheim und sein akademischer Lehrer Bernhard von Cotta.
Schließlich wurde Boakye nach “Indie” (heute Indonesien) auf die Insel Java geschickt. Dort arbeitete er nach einander als Bergbau- Ingenieursanwärter, als Kaffeepflanzer und schließlich als Privatier. Aber er wurde nicht glücklich. Als Schwarzer wurde Boakye trotz seiner vorzüglichen Ausbildung gegenüber seinen weißen nieder- ländischen Kollegen benachteiligt. Weder schützte ihn sein hoher sozialer Status, noch respektierte man seine bergbaulichen Erfahrungen.

Boakye starb 1904 im Alter von 77 Jahren. Bis zum Schluss hatte er den Kontakt zu seinen deutschen Freunden und Kommilitonen gehalten. Diese erinnerten sich vor allem an seine außergewöhnlichen Talente, seine charakterliche Bildung und seine beeindruckende Menschlichkeit.
Außer seinen Studien und der Wahrnehmung von Interessen in ihrem Umfeld hatten besonders zwei Ereignisse Boakye Selbstbewusstsein und sein akzentuiertes Gerechtigkeitsempfinden geprägt: 1849 hatte es im nahen Dresden revolutionäre Aufstände des nach Freiheiten strebenden Bürgertums gegeben. Lehrer und Kommilitonen seiner Akademie hatten sich daran beteiligt. Außerdem hatte Boakye mit seinem Lehrer von Cotta eine Exkursion in die Tiroler Alpen unternommen. Diese weitete sein Weltbild erheblich.
Wo immer es ihm möglich war, versuchte Boakye, seinen Idealen von Gerechtigkeit und der Gleichheit aller Menschen Geltung zu verschaffen. Sei- ne geradlinige Haltung als Schwarzer, der rassistischer Diskriminierung trotzte, wurde später hervorgehoben und er selbst in eine Reihe mit Booker T. Washington gestellt, dem Vorkämpfer für die Rassengleichheit in den USA.

(Aquasie Boachi, 1827 – 1904)

(1856 – 1915)
Ira Frederick Aldridge
(1807 – 1867)
Der erste schwarze Shakespeare-Darsteller der Welt

Aldridge kam in New York City zur Welt und spielte bereits dort kleinere Rollen am „African Grove Theatre”.
Als Teenager emigrierte er nach Großbritannien. Im Herbst 1825, im Alter von 18 Jahren, bekam er bereits seine erste Hauptrolle an einem kleinen Londoner Theater.
Er spielte Othello, der neben Macbeth, Richard III., Shylock, Mohr im „Fiesco“ und anderen zu seinen beliebtesten Rollen gehörte.

Ein Afrikaner auf den Bühnen Großbritanniens spielte klassische Rollen. Nach Jahrhunderte andauerndem transatlantischen Sklavenhandel war das außergewöhnlich. Die Menschen besuchten das Theater in großen Scharen, die Kassen klingelten. Ein „Wilder” spielte Shakespeare!
Die Zeitschrift „L‘ Independence Beige“ veröffentlichte eine lobende Kritik von Aldridges Aufführung. Diese erschien in der Folge auch in verschiedenen deutschen und österreichischen Zeitungen. Darunter waren zwei der führenden deutschen Theaterzeitungen: Die Berliner „Deutsche Theater- Zeitung” und die in Leipzig herausgegebene „Allgemeine Theater- Chronik”. So viel gute Werbung brachte Aldridge eine Reihe von Auftritten in ganz Deutschland ein.
Aldridge begann 1852 in deutschen Theatern aufzutreten. Er war damals 45 Jahre alt und hatte mehr als 27 Jahre Bühnenerfahrung.
Kritiker schrieben waren sich uneinig, ob Aldridges „unheimlicher” Stil ein Produkt der Natur oder der Kunst sei. War er authentisch afrikanisch oder theatralisch britisch? Man stritt:
- Sein Stil sei „natürlich”, da Afrikaner von Natur aus theatralisch seien.
- Es sei erlernte Kunst und er beweise somit, dass Afrikaner ausgebildet und zivilisiert werden könnten, wenn man ihnen die Möglichkeit gebe, ihren Intellekt und ihre Talente zu fördern.
- Er stelle eine perfekte Mischung von angeborener Wildheit und europäischer Zurückhaltung und Schliff dar.
Die Debatte spitzte sich zu, als Aldridge im Januar 1853 zum Theaterspielen nach Berlin eingeladen wurde.

Berlin: Seine Majestät, König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen verlieh Al- dridge die Preußische Gold-Medaille erster Klasse für Kunst und Wissenschaft, nachdem er Aldridges in Berlin und in einer gesonderten Aufführung in Potsdam gesehen hatte. Diese Medaille war ein Vorbote für die vielen Auszeichnungen und Ehrungen, die man ihm später in ganz Europa verlieh.
Aldridge war nun überall ein gefragter Mann. Er bekam europaweit Anfragen und begab sich auf lange Reisen, wobei er auch in kleineren Städten am Weg gastierte. Von 1852 bis 1855 reiste Aldridge 33 Monate lang durch den Kontinent. In Deutschland spielte er in:
Frankfurt (Main)
Frankfurt (Oder)
Dresden
Hamburg
Kiel
Bremen
Karlsbad
Rostock
Stralsund
Schwerin
Lübeck
Magdeburg
Braunschweig
Halberstadt
Nordhausen
Heidelberg
Speyer
Saarbrücken
Fürth
Ulm
Er spielte auch in anderen Ländern des deutschsprachigen Raums.
In den Niederlanden in:
Amsterdam
Den Haag
Rotterdam
Utrecht
Leiden
Haarlem
Danach verbrachte Aldridge die meiste Zeit seiner Karriere weiter östlich, zumeist in Russland, wo er als einer der größten Tragöden der Welt gefeiert wurde. Aber in der Zeit seiner europäischen Wanderlust zwischen 1852 und 1855 hatte er einige seiner größten Erfolge auf der Bühne gehabt.

Curtis Jackson
7/22/2010

Aldridges bemerkenswerte machte ihn zu dem am meisten wahrgenommenen schwarzen Schauspieler in Europa in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Als solcher konnte er bei vielen Europäern, die ihn spielen sahen, Rassenvorurteile abbau- en. Er galt als ein äußerst kultivierter Mann und setzte damit den alten Stereotypen vom grausamen, wilden Afrikaner ein anderes Bild entgegen.
Wer Aldridge persönlich kennen lernte, war von seiner Bescheidenheit, seiner ausgeprägten Intelligenz, seinen guten Manieren und seinem heiteren Sinn für Humor beeindruckt.
John Glatty (1872 – mindestens 1910)
Ein erfolgreicher, aber nicht unumstrittener Gastronom

Am 24. Dezember 1894 heiratete die Kellnerin Marie Köhler ihren Kollegen John Glatty aus Sierra Leone. Sie wurden in der „Kirche zum Heiligen Kreuz“ in Dresden getraut. Die Braut war einunddreißig Jahre alt, der Bräutigam neun Jahre jünger. Er hatte sich kurz vorher evangelisch taufen lassen.
Die beiden wollten sich mit Maries Erspartem selbständig machen. Sie richteten am Fabrikufer an der Elbe eine Wirtschaft ein, die sie das „Afrikanische Bierhaus“ nannten.
Sie versuchten alle Auflagen zu erfüllen. Das Gewerbeamt hatte nichts einzuwenden, aber die Polizeidirektion meldete Bedenken an: Es gebe in der Fabrikvorstadt mehr als genug „Schnapswirtschaften“, das begünstige die Trunksucht. Zudem sei zu befürchten, dass „besagter Glatty“ infolge seiner „Zugehörigkeit zur Negerrasse“ seinen Gästen gegenüber nicht immer die erforderliche Autorität zur Geltung bringen könne.
Glatty fand immer wieder neue Argumente:
- Die Stammkundschaft, Arbeiter und Elb- schiffer, würden am Feierabend, wie offen- sichtlich der Brauch in Deutschland, zum Bier gern ein Gläschen Schnaps trinken.
- Seine Frau sei als gebürtige Deutsche sei seit Jahren mit dem hiesigen Gastgewerbe vertraut.
- Er selber, ein Mann von Welt, sei aufgrund zahlreicher Reisen in alle Erdteile in maßge- benden Kreisen sowie bei einem breiten Publikum bekannt.

Schließlich zogen Marie und Johannes Glatty in die Altstadt. An der Großen Brudergasse pachteten sie ein Restaurant mit dem Namen „Zum Chinesen“. Sie durften Schnäpse, Cognac und Liköre servieren. Aber sie durften nicht das Etablissement zum „Original Afrikanischen Konzerthaus“ umbennen. Dabei hätte der Name gut gepasst, da sie afrikanisches Personal hatten und jeden Abend Live- musik spielten. Das Lokal erfreute sich großer Beliebtheit.
Während der Messe im Hochsommer betrieb Glatty das „Afrikanische Bierzelt“ auf der Vogelwiese. Die Gäste kamen von weit her, um bis in die Nacht hinein Exotisches zu konsumieren.Trotz dieser Erfolge wurden die Gastleute offensichtlich dauerhaft von der Polizei beobachtet. Es existiert eine Personalakte von John Glatty, in der Randbemerkungen darauf schließen lassen, dass man sich so- gar für das Privatleben der Eheleute interessierte.
In dieser Akte steht geschrieben, es habe „Szenen“ zwischen den Glattys gegeben. Der Mann sei wochenlang unterwegs, seine Frau mit dem Betrieb überfordert. Das könne zu Exzessen führen. Diese Behauptungen wurden offensichtlich nie bewiesen.
Am 11. Juni 1900 wurde bei der Sittenpolizei ein Brief von Marie Glatty abgegeben. Sie wandte sich verzweifelt an die Behörden und beschuldigte ihren Mann der Untreue. Außerdem belastete sie ihn mit der Behauptung, er lasse die Wirtschaft zu einem Bordell zu verkommen.Ein weiterer Brief war an Herrn Glatty adressiert und wurde offensichtlich von ihm bei der Polizei abgegeben. Die Blumenbinderin „Elisabeth“ behauptete, sie habe bei einem Treppensturz eine Fehlgeburt mit einem schwarzen Kind erlitten. Dieses sei das „Ergebnis“ einer Vergewaltigung von Glatty gewesen. Sie verlangte Schadensersatz für Arztkosten, Erwerbsausfall und den Ruin ihres guten Rufs und sie drohte mit dem Staatsanwalt. In einer dritten Anklage beschuldigte Marie Glatty wiederum ihren Mann, sich auf eine Affäre mit dem minderjährigen Buffetmädchen Klara Alumaria eingelassen zu haben, die als Kind aus Ostafrika nach Deutschland gekommen war.
Ein Wachtmeister „Leichsenring“ sollte die Anschuldigungen bear- beiten. Obwohl er erst seit zwei Jahren bei der Sittenpolizei ange- stellt war, war er anscheinend bereits mit dem Fall Glatty vertraut.Alle Anschuldigungen erwiesen sich letztlich als haltlos oder es stand Aussage gegen Aussage. Mit Elisabeth hatte Glatty ein Ver- hältnis gehabt, aber es war einvernehmlich gewesen und für die an- gebliche Fehlgeburt gab es keine Zeugen. Die Vaterschaftsklage wurde als reine Erpressung zurückgewiesen. Klara Alumaria gab bei einer Befragung zu Protokoll, die Situation, als Frau Glatty ihren Mann in ihrem Zimmer gesehen hatte, sei unverfänglich gewesen.
Marie Glatty selbst hatte eine außereheliche Beziehung, was ihre Glaubwürdigkeit untermauerte. Sie beruhigte sich schließlich. Zwi- schenzeitlich war sie negativ aufgefallen, als sie versuchte, Druck auf die Behörden auszuüben. Sie behauptete, ihr Mann wolle das Geschäft hinter ihrem Rücken verkaufen.
Drei Jahre lang schienen die Angelegenheiten in Vergessenheit zu geraten.Dann folgte eine weitere Anzeige bei der Sittenpolizei. Diesmal kam sie von einem ehemaligen Kellner. Er belastete Glatty einerseits mit der Aussage, dieser habe sich im Restaurant „Zum Chinesen“ nie an die Preisliste gehalten. Andererseits behauptete er, er hätte gesehen, dass Glatty seine Buffetmädchen nach Geschäftsschluss mit Stammkunden wegziehen ließ und stillschweigend in Kauf nahm, dass sie ganze Nächte außer Haus verbrachten. Auch Marie sei hierin verwikkelt gewesen.
Diesmal wurde ein Oberaufseher namens Fähnig beauftragt, der Sache auf den Grund zu gehen. Dieser nahm die Angelegenheit sehr ernst und verfasste im Januar 1903 einen Bericht. Er konnte trotz intensiver Recherche „nichts Anstößiges“ finden, verwarnte Glatty aber und kündigte strenge Kontrollen an. Der ehemalige Kellner drohte, weitere Zeugen heranzuziehen.Glatty fühlte sich offenbar in die Enge getrieben. Er beschloss, die Stadt und das Land zu verlassen und spielte zwischenzeitlich sogar mit dem Gedanken, zurück in seine afrikanische Heimat zu gehen.
Stattdessen zog er nach Zürich in die Schweiz und gab seine Konzession für das Restaurant „Zum Chinesen“ ab.
Seine englische Staatsbürgerschaft und den Pass mit seinem englischen Namen hatte Glatty eventuell durch seine Mutter in Sierra Leone erhalten. Vielleicht hatte er sie aber auch durch eine englische Familie bekommen, der er als Kind gedient hatte und mit der er als Jugendlicher eine Reise nach Panama und später nach Europa bzw. Deutschland antrat. So landete Glatty 1890 in Berlin. Eine weitere Theorie sagt, ihm hätte durch seine Geburt in deutschem Schutzgebiet die deutsche Staatsbürgerschaft zugestanden. In Berlin wäre er aber ohne gültige Papiere gewesen und hätte sich „aus der Not heraus“ einen englischen Pass machen lassen. Spätestens vor dem jetzigen Umzug in die Schweiz jedenfalls ließ Glatty sich einen englischen Pass ausstellen.
In Zürich betrieb Glatty für kurze Zeit ein Zigarrengeschäft. Dann kaufte er laut Grundbucheintrag für 22.000 Franken ein Haus am Predigerpatz 54. Das war ein dreistöckiges Eckhaus mit einer Gaststube im Parterre. Darin befand sich eine traditionsreiche Wirtschaft mit dem Namen „Zum Prediger“. Glatty machte jede Woche Werbung für sein Lokal, und zwar mit Annoncen im „Tagblatt“. Diese variierten immer etwas in ihrer Wortwahl. Es wurden u. A. „musikalische Unterhaltung“ angeboten sowie „Bier vom Fass und Weine“, „gute Küche und Bedienung“. Weitere Formulierungen lauteten: „schwarze weibliche Bedienung durch Miss Elizabeth, die hübsche Negerin aus Westafrika“.

Pastell, 34 x 28 cm, Dresden, Gemäldegalerie aus dem Zyklus „Die vier Erdteile“
Auch in der „Zürcher Wochen-Chronik“ war man auf den neuen Wirt aufmerksam geworden. Es wurde ein Foto von ihm abgedruckt unter dem geschrieben stand: „Johannes Glatty, der erste schwar- ze Grundbesitzer in Zürich“. Zudem war unter Rubrik „Sehenswür- digkeiten“ ein kurzer Lebenslauf über den fremden Wirt in Umlauf gebracht worden. Darin stand u.A., er sei „mit acht Jahren Haus- diener bei einer englischen Familie geworden und später mit seiner Herrschaft nach Panama gereist, im folgenden Jahr… nach Berlin und Dresden, wo er sich selbständig gemacht und eine Deutsche geheiratet habe.“ „Nun gedenke er, das Zürcher Bürgerrecht zu erwerben“, schloss der Bericht. Diese letzte Notiz wirkte ange- sichts der veränderten Lage wie ein schlechter Witz. An das Bür- gerrecht war nicht zu denken, auch das Wirtepatent hatte John Glatty nie erhalten. Es wurde ihm mit der Begründung verweigert, er habe seine Ehefrau böswillig verlassen.Der Polizeivorstand hatte sich eingeschaltet und bezog sich wohl auf einen alten Bericht des Wachtmeisters Leichsenring, indem er zitierte, „aus der … Negerwirtschaft würde offenbar eine so genannte Krach- und Skandalwirtschaft, zur Plage und zum Ärger der Einwohnerschaft und der Behörden.“ Da sei nichts mehr zu machen. So sehr Glatty sich bemühte, mit Hilfe eines Anwalts diesen Bericht anzufechten; sein Widerspruch wurde vom Regierungsrat abgewiesen. Ebenso chancenlos blieb der Versuch, das Wirtepatent für Marie Glatty zu erhalten.
Marie war anscheinend nachgezogen und wohnte neuerdings wieder mit ihrem Ehemann zusammen. Doch das Verhältnis der beiden wurde als „heillos zerrüttet“ beurteilt. Man vermutete, Marie Glatty sei nur von ihrem Ehemann vorgeschobenen worden, nachdem man John Glatty „aus schwerwiegenden Gründen“ die Führung einer Gastwirtschaft habe verweigern müssen. Marie Glatty blieb noch eine Weile am Predigerplatz wohnen.Vorübergehend lebte Glatty in Wien/ Österreich und Breslau. Zurück in Deutschland, betrieb er erst einmal wieder ein Zigarrengeschäft.
Doch schon im Frühjahr 1906 zog er weiter nach Leipzig. Marie soll ebenfalls in Wien und Breslau aufgetaucht sein. Aber es scheint, die beiden reisten mehrmals aneinander vorbei und lebten nun getrennt.
In Leipzig hatte Glatty endlich einmal wieder Glück. Er konnte in der Querstraße 32 eine Wirtschaft „Zum Afrikaner“ eröffnen. Zwar wurden wieder Auskünfte aus Dresden über ihn eingeholt, aber diesmal bloß beim Gewerbeamt. Es wurden wenige Fragen gestellt, die kurz positiv beantwortet wurden. Das Restaurant lief gut und brachte genug zum Leben ein. Herr Glatty reichte die Scheidung ein. Da er und Marie keine Kinder hatten, schien alles nur noch eine Formalität zu sein. Glatty hatte sich an die Anwaltskanzlei Krake und Georgi gewandt und beantragte die sächsische Staatsbürgerschaft. Der Antrag wurde trotz Widerruf und vieler Argumente der Anwälte sowie ohne einsehbare Begründung abgelehnt.
1910 verkaufte Glatty seine Wirtschaft und zog weiter. Sein Ehe wurde in diesem Jahr geschieden. Ab diesem Zeitpunkt fehlt von ihm jede Spur. Es ist nicht bekannt, wohin er zog, ob er weitere Lokale eröffnete, ober in Deutschland bzw. Europa blieb, noch einmal heiratete, Kinder bekam oder wann er starb.

Christian Jakob Protten
(1715 – 1769)
& seine Frau Rebecca
(1718 – 1780)
Ein Missionarsehepaar mit multikulturellem Hintergrund
Der Name Christian Jakob Protten klingt eigentlich typisch europäisch. Tatsächlich war sein Vater ein dänischer Soldat, den er aber nicht kennenlernte. Christian Jakob war dunkelhäutig, denn er kam von der Goldküste. Sein Großvater mütterlicherseits war der Stammesfürst Chief Ashangmo, Herrscher in der Volksgruppe der Ga. Protten ging auf eine „Mulattenschule“ in der dänischen Festung Christiansborg. Das Gebäude war zur selben Zeit Sklavenburg und Handelsstützpunkt. Heute ist es der Sitz des Präsidenten von Ghana.
Im Alter von 11 Jahren kam Protten zusammen mit seinem Lehrer Prediger Svane und seinem Mitschüler Frederik Pedersen nach Kopenhagen/ Dänemark. Beide wurden getauft und der damalige König Friedrich IV (1699- 1730) wurde ihr Pate. In Kopenhagen führte Prottens europäisch klingender Name zu Missverständnissen. Als Erwachsener nahm er deshalb zusätzlich den Namen „Africanus“ an.
Protten und Pedersen gingen zunächst in die Lehre bei einem Schmied, was ihnen aber nicht gefiel. Danach sorgte Prediger Svane dafür, dass sie Theologie an der Universität von Kopenhagen studieren durften. Doch die Glaubensdiskussionen der Theologen wurden damals bereits von vielen Europäern verspottet. Auch die beiden Studenten aus Afrika konnten sich nicht so recht dafür erwärmen. Sie hatten den Mut, ihre Kritik zu äußern. Daraus leitete der dänische Bischof „afrikanische Selbstgerechtigkeit“ und „Hochmut“ ab.
Ab hier trennten sich die Wege der beiden jungen Männer. Pedersen absolvierte sein Examen und heiratete eine Dänin. Das Ehepaar ging in die Mission zurück nach Afrika.
Protten machte keinen Abschluss.
Er durchlebte eine schwierige Phase, in der er versuchte, sich neu zu orientieren. Auf keinen Fall wollte er Missionar werden. Durch Vermittlung lernte er Graf Nikolaus von Zinzendorf kennen, der 1722 die heute sehr bekannte Brüdergemeine im ostsächsischen Herrnhut gegründet hatte.
Protten zog dorthin, denn er sah für sich die Chance, in Herrnhut eine neue geistige Heimat zu finden.

Nach einem Jahr in Herrnhut segelte Protten 1737 mit seinem Glaubensbruder Henry Huckuff von Amsterdam/ Niederlande als Herrnhuter Missionar an die Goldküste. Nur einen Monat nach ihrer Ankunft in Elmina starb Huckuff. Daraufhin änderte Protten seine Pläne und be- suchte seine Mutter in ihrem Heimatort Little Popo (Anecho) im heutigen Togo.
Er entwickelte ein Projekt und wollte in Elmina eine Schule eröffnen.
Das Problem war, dass Protten, der bei den Herrnhutern gleichberechtigt behandelt worden war, eigene Vorstellungen umsetzen wollte.
Das legte ihm der niederländische Gouverneur als mangelnde Bereit- schaft zur in der Kolonialpolitik üblichen Kooperation aus. Er verdäch- tigte Protten, ein dänischer Spion zu sein und ließ ihn gefangen nehmen.
Diese Gefangenschaft dauerte mehrere Jahre. Erst spät erfuhr die Brüdergemeine davon. Sie beriefen Protten zurück nach Europa; dadurch kam er frei. Sein Weg führte ihn auf der transatlantischen Handelsroute über die Karibik. Dort blieb Protten freiwillig drei Jahre lang. 1745 kehrte er nach Herrnhut zurück. Ein Jahr später heiratete Protten seine Frau Rebecca, die einige Jahre vorher aus der Karibik nach Deutschland gekommen war.
Es wird vermutet, dass ihre Mutter eine Sklavin war, die das Kind von einem weißen Plantagenbesitzer bekam. Rebecca hieß ursprünglich Shelly. Sie wurde als Kind von ca. 6 Jahren entführt und kam auf die Insel St. Thomas zu einem dänischen Plantagenbesitzer. Dort arbeitete sie im Haus, durfte lesen und schreiben lernen und erhielt biblischen Unterricht. Sie wurde auf den Namen Rebecca getauft und wurde eine eifrige Christin. Die Familie entließ sie in die Freiheit. Rebecca lernte einen Herrnhuter Missionar kennen. Dieser vermittelte sie als Missionarsfrau an seinen Glaubensbruder Matthias Freundlich. Die beiden heirateten 1738. Diese offizielle Eheschließung betrachteten die Rassisten in der Kolonialgesellschaft, darunter Geistliche der Niederländischen Reformierten Kirche, als einen Affront. Die Kolonialverwaltung ließ das Ehepaar ins Gefängnis werfen. Zinzendorf konnte sie befreien und sorgte dafür, dass sie über Amsterdam nach Deutschland kommen konnten. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Paar eine Tochter. Der Mann starb. Rebecca und Protten lernten sich bei den Herrnhutern ken- nen.1750 wurde ihre erste gemeinsame Tochter Anna-Maria geboren. Für viele Mitglieder der Brüdergemeine war es eine große Überraschung, dass Anna-Maria „weiß” war. Einige Gemeinemitglieder haben die Hautfarbe des kleinen Mädchen mit dem „rechten christlichen Glauben” der Eltern erklärt. Die Direktion der Unität war so beeindruckt, dass sie die Familie porträtieren ließen. Das als Postkarte reproduzierte Gemälde wird bis auf den heutigen Tag in Herrnhut viel verkauft. Anna- Maria starb im Alter von vier Jahren.
Da die Herrnhuter Direktion Protten nicht wie von ihm gewünscht zur Goldküste zurückkehren lassen wollten, suchte er einen anderen Weg.
Protten wurde Angestellter der „Royal Chartered Danish West India and Guinea Company”, von der er 1757 den Auftrag erhielt, in seiner alten Schule auf der Christiansborg zu lehren und zu predigen. Dort passierte ein Unglück. Einer seiner Schüler starb, als Protten seine Pistole reinigte. Protten kehrte nach Europa zurück; 1762 erreichte er Herrnhut.
1765 konnten Protten und Rebecca zusammen an die Goldküste gehen.
Er übernahm die Leitung der Schule bis zu seinem Tod vier Jahre später.Sein Plan für ein Internat, den er 1764 dem Sohn seines Patenonkels König Frederick V von Dänemark (Regierungszeit 1746-1766) vorlegte, zeigt Prottens Bewusstsein für die Stelle der afrikanischen Sprachen im Lehrplan.
Protten hatte eine grammatische Einführung in die Fante und Ga Sprachen geschrieben. Diese wurde 1764 in Kopenhagen veröffentlicht. Er übersetzte auch Martin Luthers Kleinen Katechismus in Ga und Fante.
Er hat ein umfangreiches Schrifttum, besonders Tagebücher aus Afrika und Europa hinterlassen.
Rebecca blieb in Accra und übernahm die Leitung der Schule. Sie starb elf Jahre nach ihrem Mann. Jon Sensbach sagte über sie, Rebecca habe die christliche Religion als Möglichkeit entdeckt und genutzt um soziale, kulturelle und geogra-phische Grenzen zu überwinden. Sie hatte bei den Herrnhutern große Anerkennung gefunden. Ihr starker Glaube half ihr über Schicksalsschläge hinweg. Während ihr Mann beständig um seine afrikanische und europäische Identität gerungen hatte, zeigte Rebecca solche Zweifel zumindest nicht nach außen.

Quellen:
- Allison Blakely, Blacks in the Dutch World: The Evolution of Racial Imagery in a Modern Society
- Christopher H. Johnson,Transregional and Transnational Families in Europe and Beyond: Experiences …
- Hans Debrunner, A History of Christianity in Ghana (1967); P. Steiner, Ein Blatt aus der Geschichte der Geschichte der Brudermission (1888).
- Jon F SensbachRebecca’s Revival, Creating Black (1967); P. Steiner, Ein Blatt aus der Christianity in the Atlantic World.
- Klaus Koschorke ,Außereuropäische Christentumsgeschichte
- Marshall, Herbert/Stock, Mildred: „Ira Aldridge. The Negro Tragedian“, London 1958.
- Mortimer, Owen: „Speak of Me As I Am“. The Story of Ira Aldridge, Wangaratta/ Australia 1995.
- Rea Brändle: Wildfremd, hautnah. Völkerschauen und Schauplätze. Zürich 1880-1960. Bilder und Geschichten. Zürich, 1995.
- Rea Brändle: Nayo Bruce, Geschichte einer afrikanischen Familie in Europa. Zürich, 2007. Sankofa. Plattform für Menschen afrikanischen Erbes (Zürich): www.sankofa.ch
- Sadji, Uta: Ira Aldridge (1805-1867). Acteur africain sur des scenes allemandes, in: Etudes Germano-Africaines, Nr. 9, Dakar 1991, S. 91-95.