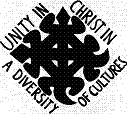Zunächst möchte ich kurz auf eine Fragestellung eingehen, die in unserem Konferenzflyer formuliert wurde: „Wie ist sicherzustellen, dass Gemeindeleben und Diakonie, Glauben und Nächstenliebe nicht auseinander driften, sondern zusammen bleiben?“ Meine kurze Antwort hierauf ist: Wir sollten immer danach streben, Jesu Liebe als Basis unserer Beziehungen und unserer Arbeit zu leben. So haben es die Menschen in den ersten Gemeinden getan (Apostelgeschichte Kapitel 4.6.11). Nun komme ich zu der Frage: Wie helfen wir denen, die Hilfe brauchen? Ich würde sagen, wenn eine Person anderen helfen will, sollte sie ein Herz für die Probleme der anderen haben. Sie sollte bereit sein, sich in diese Probleme hinein zu begeben, um sie zu verstehen und nicht von oben herab Hilfe anzubieten, sondern als jemand, der bereit ist zu dienen- so wie ein Bruder, eine Schwester, ein Freund (Hesekiel 3, 13- 15; Hiob 11, 13).
1. Schaue über deinen Tellerrand
Über die Jahrhunderte wurden Christen immer wieder von den biblischen Texten in- spiriert, den Armen und Bedürftigen zu helfen. Otto von Freising schreibt: „Offen ge- sagt, weiß ich nicht recht, ob der heutige Wohlstand der Kirche Gott besser gefällt als ihre frühere Demut. Dieser frühere Zustand war vielleicht besser, aber der momenta- ne ist angenehmer!“ Otto von Freising lebte im Römischen Reich des 12. Jahrhun- derts. Er war ein Mann, der über seinen Tellerrand hinaus schaute. Er identifizierte das Reich Gottes mit der bestehenden Kirche und sah es in der politischen und kirchlichen Ordnung seiner Tage Früchte tragen. Trotzdem war er oft zwischen Ent- täuschung und Hoffnung hin- und her gerissen. In diesem Zwiespalt sehnte er teil- weise die einfache Kirche der ersten Tage zurück, wie sie in der Apostelgeschichte 4, 32ff beschrieben wird. Diese Sehnsucht gab später den Impuls zur sogenannten „Renaissance des 12. Jahrhunderts“. Jene erreichte ihren geistigen Höhepunkt im Leben und Wirken Franz von Assisis und seiner demütigen Anhänger.
August Francke, Graf von Zinzendorf, Friedrich von Bodelschwingh, Georg Müller, Hudson Taylor, William Carey, William Wilberforce, Florence Nightingale, Martin Lu- ther King, Mutter Teresa, Nelson Mandela oder Erzbischof Desmond Tutu hatten alle einen starken Glauben und die Motivation, etwas in ihrem Umfeld zu bewirken. „Es liegen nicht immer große Taten vor uns. Vielmehr können wir jederzeit etwas schein- bar Unbedeutendes richtig gut machen. Das tun wir, indem wir es mit Liebe tun“ (St. Francis de Sales). Jeder von uns hat Bedürfnisse und jeder von uns hat Gaben (1. Petrus 4, 9-11; Römer 12, 3-13). Darum und auf diese Weise sollten und können wir einander helfen.
Sollten wir Christen nicht Gottes Hände sein, um zu helfen?
Sich „Christ“ zu nennen, geht mit dem Privileg und der Verantwortung einher, ein Le- ben lang zu dienen. Das Leben Jesu ist ein lebendiges Vorbild, welches uns lehrt, für die Menschen um uns herum da zu sein. Die Bibel sagt uns, wie wir mit unseren Mit- menschen umgehen sollen. Besonders die armen, bedürftigen und durch Krieg oder andere Gewalt vertriebenen Menschen brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit.
Wir sollen ihnen dienen, egal, welcher Rasse, welchem Geschlecht oder welcher Religion sie angehören. Wir dürfen froh sein, wenn wir anderen helfen können, und sollen keine Gegenleistung von ihnen erwarten. „Freundlichkeit ist eine Sprache, die die Stummen sprechen und die Tauben hören“, sagte C.N. Bovee. Wenn wir anderen dienen, praktizieren wir, was Jesus tat. Wir werden dadurch mit denjenigen, denen wir helfen, verbunden, und empfangen eine Bestätigung, die uns egoistisches Handeln niemals bieten kann. Manche Menschen handeln humanitär und beantworten so die Gebete der Verzweifelten. Ich bin sicher, dass Gott jede Hilfe für Menschen in Not beachtet, egal, ob die Helfenden sich zur Kirche zugehörig fühlen oder nicht.
Aber diejenigen, die es tun, haben sozusagen keine Wahl. Gott macht mehr als deut- lich, dass er soziales Engagement von uns erwartet. Darum ist es für uns keine Option, sondern eine Verpflichtung, jederzeit unser Bestes zu geben, um anderen zu helfen. Nicht zuletzt sollten wir dabei aber auch an das geistige Wohl derer denken, um die wir uns kümmern. Jesus hatte immer den ganzen Menschen im Blick. Körperliche und soziale Bedürfnisse wie Essen und Trinken, medizinische Versorgung oder Arbeit sind alle wichtig. Aber genauso wichtig ist das geistige Leben. Jesus kümmerte sich sowohl um das körperliche als auch um das geistige Wohl der Menschen. Sie vergaßen niemals, was er ihnen von der Liebe Gottes erzählte, weil sie diese zugleich in praktischer Weise erfuhren. „Wenn ich meine (Lebens-) Zeit noch einmal vor mir hätte, würde ich mich mehr für soziale Gerechtigkeit als für politische Beziehungen einsetzen“ (Billy Graham).
3. Viele Menschen riskierten für andere sogar ihr Leben

Pennington wurde als Sklave in Washington County, Maryland geboren. Nachdem er nach Petersburg (heute York Springs) in Pennsylvania geflüchtet war, ging er 1828 nach New York. Er ließ sich als Schmied in New Haven, Connecticut nieder und nahm von 1834 bis 1839 am Unterricht der Yale Divinity School teil. Er war der erste dunkelhäutige Mann an dieser Schule. Später wurde Pennington ein Prediger der Presbyterianischen Kirche, Lehrer, Buchautor und Freiheitskämpfer. Er schrieb z.B. The Origin and History of the Coloured People (Ursprung und Geschichte von farbigen Menschen), 1841. Dieses Buch nannte man das „erste Buch über die Geschich- te der Afroamerikaner“. Außerdem schrieb Pennington eine autobiografische Skla- vengeschichte The Fugitive Blacksmith (Ein Schmied auf der Flucht), 1850. 1849 verlieh ihm die deutsche Universität Heidelberg den Ehrendoktortitel der Theologie. Dies kam dadurch zustande, dass der Heidelberger Theologe Friedrich Wilhelm Ca- rové ein demokratischer Aktivist, Leiter der internationalen Friedensbewegung und sehr beeindruckt von Pennington und dessen Botschaft war. Carové sah die Mög- lichkeit, durch diese Auszeichnung nicht nur Pennington in seiner Sache zu unter- stützen, sondern auch die demokratische Freiheitsbewegung in Deutschland voran- zutreiben. In einer Zeit, in der Wahrheit als Lüge und Dunkelheit als Licht bezeichnet wurde, gab es dennoch Menschen, die sich trauten, für Gerechtigkeit einzutreten. Pennington selbst erfuhr Hilfe von Christen wie den Quäkern, Methodisten und Pres- byterianern. Durch die Liebe, die sie ihm schenkten, und die Hilfe, die er durch sie erfuhr, konnte er die traumatischen Erfahrungen aus der Sklavenzeit überwinden und später selbst vielen anderen Menschen helfen. Lasst uns ebenfalls wachsam sein, wenn Menschen um uns herum Hilfe brauchen! Jesus, die Apostel und viele Men- schen nach ihnen sind schon diesen Weg der praktizierten Liebe gegangen. Ihre Einstellung kann uns helfen, ebenfalls Gottes Wirken in unserem täglichen Leben zu erfahren.


Truth traf 1864 den Präsidenten Abraham Lincoln. Dieses Bild malte später Albion aus Michigan für den Franklin Courter. Lin- zeigt ihr seine Bibel, die er von „Afrikanischen Menschen“ in Baltimore hatte.
Als Kind von Sklaven geboren, verbreitete Sojourner Truth die Flammen der Freiheit im ganzen Land bis hin zum Kongress, wo sie zu Präsident Abraham Lincoln sprach. Als Frau war sie mutig genug, sowohl für die Freiheit und Rechte der befreiten und zu befreienden Sklaven in den USA als auch für die Rechte der Frauen zu kämpfen. Ohne Hoffnung geboren, empfing sie einen Ruf von Gott und begann, eine tief emp- fundene Botschaft zu predigen. Sie sagte, dass wir unsere Liebe zu Gott am besten in unserer Fürsorge für andere ausdrücken können. Wo immer Sojourner auftauchte, nahmen ihre weisen Worte und ihre starke Ausstrahlung ihre Zuhörer für sie ein. Die meisten ihrer Zuhörer waren weiße Menschen, oft auch Pastoren. Sojourner forderte sie in bestechenden Worten heraus, sich gegen Ungerechtigkeit aufzulehnen. Damit eroberte sie sich einen Platz in der amerikanischen Geschichte als eine Frau von starkem Mut und großem Glauben.

Douglass war ein amerikanischer Sozialreformer, Redner, Autor und Staatsmann. Nachdem er aus der Sklaverei geflohen war, wurde er ein Anführer der Anti-Sklaverei-Bewegung. Seine umwerfenden Reden und prägnanten Bücher brachten ihm viel Aufmerksamkeit ein. Er war ein lebendes Beispiel dafür, dass die Argumente von Sklavenhaltern, Sklaven wären nicht intellektuell genug, um freie Bürger Amerikas zu werden, Unsinn waren. Sogar im Norden der Vereinigten Staaten, wo die Sklaverei früher abgeschafft wurde, konnte man kaum glauben, dass so ein großartiger Redner einst ein Sklave gewesen war. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg und der endgültigen Abschaffung von Sklaverei
auch im Süden des Landes setzte sich Douglass weiter aktiv dafür ein, dass das neue Amerika nicht nur vom Namen her ein „freies Land“ werden sollte. Er unterstützte auch aktiv die damalige Frauenbewegung. Nach dem Krieg kämpfte er dafür, dass die befreiten Sklaven die gleichen Rechte wie alle Amerikaner bekamen und bekleidete eine große Anzahl öffentlicher Ämter. Douglass war jemand, der ei- nen starken Glauben hatte, dass alle Menschen gleich sind, egal, ob schwarz, weiß, männlich, weiblich, ob geborener oder zugewanderter Amerikaner. Er stand zu seiner Aussage: „Ich bin bereit, mich mit jedem zusammen zu tun, der Gutes tun möchte, und mit niemandem, der Böses vorhat.“

Tubman war eine afroamerikanische Aktivistin in der Anti-Sklaverei-Bewegung, eine Philanthropin und eine Spionin während des amerikanischen Bürgerkriegs. Auch sie war in die Sklaverei geboren worden. Als Kind wurde sie in Dorchester County, Maryland an verschiedene Sklavenhalter verkauft und von ihnen geschlagen. Als sie noch recht klein war, wurde sie dabei von einem schweren Metallgegenstand am Kopf getroffen. Durch diese Verlet- zung wurde ihre Entwicklung beeinflusst und sie litt ihr Leben lang unter narkoleptischen Anfällen, Kopfschmerzen und überdurchschnittlich vielen und intensiven Träumen. Aber dank ihres starken Glaubens an Gott machte sie sich über all das nie viel Gedanken.
Vielmehr begann sie, sich für andere einzusetzen. 1849 schaffte sie es, nach Phila- delphia zu fliehen. Sofort kehrte sie wieder um, um ihre Familie nachzuholen. Und dann holte sie nach und nach immer mehr ihrer Verwandten aus Maryland heraus.
Aber nicht nur das, sondern sie befreite auch noch Dutzende anderer Sklaven. Tub- man reiste immer nachts. Nie verlor sie auch nur einen ihrer „Passagiere“. Die Men- schen nannten sie “Moses”. In 13 solch abenteuerlichen Befreiungsaktionen rettete diese Frau mehr als 70 Sklaven. Tubman organisierte dafür ein Netzwerk von Aktivisten und Häusern, deren Besitzer sich ihr angeschlossen hatten. Diese Helfer waren christliche, weiße Leute, die jeweils zu einer von zwei christlichen Konfessionen gehörten, nämlich den Methodisten und den Quäkern. Die Anhänger dieser Gemeinden hatten die Sklaverei von Anfang an verurteilt und nicht mitgemacht. Die so organisierten Fluchtwege nannten die Menschen Tubmans „Untergrundlinie“. Für die entlaufenen Sklaven wurden hohe Geldsummen geboten, um sie zurück zu bringen. Aber niemand der alten Sklavenhalter hatte auch nur die geringste Ahnung, dass hinter dieser Befreiungsserie Harriet Tubman steckte. 1850 ernannte der Kongress, der von Südstaatenpolitikern dominiert wurde, ein Gesetz, das die Rückführung der entlaufenen Sklaven forderte. Das veranlasste Tubman, ihre Flüchtlinge weiter nördlich bis nach Kanada zu bringen, wo Sklaverei ganz untersagt war. Als der amerikanische Bürgerkrieg ausbrach, arbeitete Tubman für die Befreiungsarmee, erst als Köchin und als Krankenschwester, später als bewaffnete Kundschafterin und Spionin. Als erste Frau, die im Krieg eine bewaffnete Expedition leitete, befreite sie in der Combahee River Raid mehr als 700 Sklaven aus Südcarolina. Nach Ende des Krieges kehrte Tubman zu ihrer Familie in Aubum/ New York zurück und pflegte ihre alternden Eltern.
Sie wurde in der New Yorker Frauenbewegung aktiv, bis sie selbst krank wurde. Am Ende ihres Lebens lebte Tubman in einem Heim für alte Afroamerikaner, das sie in früheren Jahren selbst mit gegründet hatte. „Jeder große Traum beginnt bei einem, der träumt. Denkt immer daran: ihr habt in euch die Kraft, die Geduld und die Leidenschaft, um nach den Sternen zu greifen und die Welt zu verändern!“ (Harriet Tubman).
Dienen in der Gegenwart Gottes
Jesus sagte: „Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen“ (Matthäus 25, 35.36). All die oben genannten Menschen standen in ihrem Leben großen Herausforderungen gegenüber. Weil sie auf Gott ver- trauten, empfingen sie zuerst innere Heilung von den Wunden ihrer Vergangenheit und konnten später über sich hinaus wachsen um in ihrer Zeit an ihrem Ort das Lei- den der Menschen zu bekämpfen. Mutter Teresa sagte: “Freundliche Worte sind nicht schwer auszusprechen, aber ihre Wirkung ist unendlich.” Ihr ehrenamtlicher Dienst für die Menschen in Indien spiegelte die Gnade Gottes wieder. Es war eine freie Gabe, deren Wert niemand hätte mit Geld aufwiegen können. „Ein Herz, das sich wirklich öffnet, kann das ganz Universum fassen“, sagte Joanna Macy. Napoleon war für viele ein Held und viele andere kannten ihn gar nicht. Als Jesus gekreuzigt wurde, sahen das erst nur wenige, aber über die Jahre wurde er in der ganzen Welt bekannt. Wahre Größe finden wir in Menschen, die sich selbst eher nicht für groß halten. Jesus sagte: „…Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele“ (Markus 10, 43-45). Ein französischer Mönch des 17. Jahrhunderts wird heute liebevoll als „Bruder Lawrence“ erinnert. Er sagte: „In der ganzen Welt gibt es kein Leben, das so süß und angenehm ist wie das eines Dienstes am Menschen im ständigen Austausch mit Gott.“ Er nannte dies auch die „praktizierte Gegenwart Gottes“. Sein Gebet war: “Herr aller Töpfe, Pfannen und Dinge… Heilige mich, indem ich Mahlzeiten zubereite und hinterher abwasche!”
Die zwei gehören zusammen
Sherwood Wirt schreibt: “Soziale Aktivitäten gegen das Evangelium auszuspielen be- deutet, künstlich einen Konflikt herauf zu beschwören. Jesus hätte dem mit einem ein- zigen Satz ein Ende gemacht. Er beauftragte seine Jünger, dass sie die gute Nach- richt verbreiten sollten. Wenn sich dadurch Menschenleben zum Guten veränderten, sollte ihnen das Lohn genug sein.” Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, das Evangelium aufzuspalten. Die Kirche hat den klaren Auftrag, sich für Gerechtigkeit in der Gesell- schaft einsetzen (vgl. Psalm 82, 1-4; Amos 5, 21-24; Hesekiel 22, 1-31). Als Christen haben wir eine besondere Verantwortung für die Armen und Unterdrückten. Wie wir mit denen umgehen, die bedürftig sind und als „sozial schwach“ gelten, sollte unsere erste Priorität und keine Nebensache sein. Die Kirche sollte immer um die Nöte der Menschen bemüht sein, nicht um sich darzustellen, sondern um zu zeigen, dass Gott es gut mit uns meint. Oft hinterfragen Menschen den Anspruch der Christen, einen besonderen Glauben in einer pluralistischen Welt zu präsentieren. Wenn wir genau hinsehen werden wir feststellen, dass in ihrem Kern alle Religionen einen solchen An- spruch haben. Wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass die Menschen sowohl sozia- le als auch geistige Bedürfnisse haben. Unser Glaube soll sich durch die Werke der Liebe zeigen. In Zusammenklang mit unseren christlichen Grundsätzen sollten wir für die Menschen, die in wenig entwickelten Gebieten der Erde leben, gemeinsam Per- spektiven entwickeln. „Hilf uns, Herr, einander zu helfen und das Kreuz des anderen zu tragen. Lass jeden seinen freundlichen Beistand gewähren und die Fürsorge sei- nes Bruders spüren“ (Charles Wesley).
Im 4. Jahrhundert identifizierte der Herrscher Julian I Christen durch ihren Lebensstil. Er startete eine Kampagne, um eine säkulare Wohltätigkeit aufzubauen, die es der christlichen gleichtun sollte. In seinem Brief an Galazien 362 schrieb er, dass die Hei- den die Tugenden der Christen erlernen sollten. Er ging davon aus, dass das Wachs- tum der christlichen Gemeinde durch ihren „moralischen Charakter, selbst wenn er nur geheuchelt sein sollte“ sowie durch ihre „Mildtätigkeit gegenüber Fremden und ihre Fürsorge für die Gräber der Toten“ entstand. In einem weiteren Brief an einen ande- ren Adressaten schrieb er: „Ich denke, die Galiläer haben beobachtet, dass die Armen (von uns) pietätlos vernachlässigt und übergangen wurden, und darum haben sie sichder Mildtätigkeit hingegeben.“ Weiterhin verfasste er: „Die pietätlosen Galiläer unter- stützen nicht nur ihre, sondern auch unsere Armen; jeder kann sehen, dass unsere Leute Mangel leiden, weil wir ihnen nicht genug helfen.“
Gebet
Herr, dessen Geist uns in alle Wahrheit führt und uns befreit: Stärke uns und erhalte uns, sodass wir befähigt werden, deine Arbeit zu tun. Gib uns Visionen und den Mut, gegen Unterdrückung, Ungerechtigkeit und all das aufzustehen, was deine Kinder da- von abhalten will, in der herrlichen Freiheit zu leben, zu der du uns berufen hast. Wir beten im Namen Jesu Christi, unserem Retter, der lebt und regiert in der heiligen Dreieinigkeit- für immer und ewig. Amen.
Quellen:
Series “Heroes of Faith”, Barbour Publishing:
- Whalin, W. Terry: “Sojourner Truth- Liberated in Christ”
- Philips, Rachael: “Frederick Douglass- A Slave no more”
- Grant, Callie Smith: “Free Indeed- African-American Christians and the Struggle for Equality”
- “The Practice of the Presence of God” von Bro Lawrence
- “Conspiracy of Kindness” von Steve Sjogren
- “The community of the King” von Howard A. Snyder
- “Side by Side” von Steve and Lois Rabey
- Johnson 1976:75; Ayerst and Fisher 1971:179-181, pp. 83-84
Studientag Kirche Interkulturell, Hannover 2013
Pastor Peter Arthur aus Ghana, Akebulan (Globale Mission) e.V. in Berlin
(www.akebulan-gm.org)